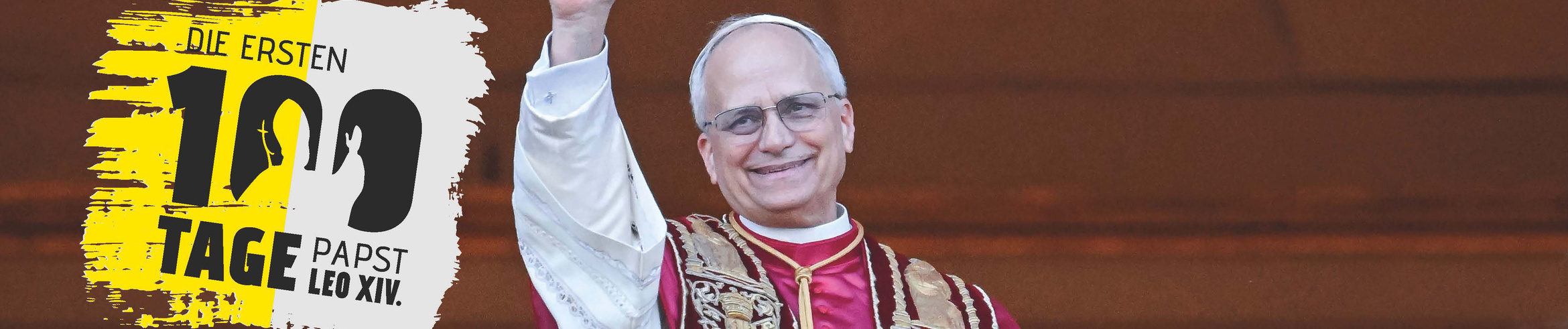Frau Dr. Ries, wann beginnt die Geschichte des Judentums im heutigen Unterfranken?
Unterfranken, insbesondere Würzburg, ist eine Region, die recht tiefe jüdische Wurzeln hat. Auch wenn es nicht 1700 Jahre sind, kann Würzburg doch auf eine 900-jährige jüdische Geschichte zurückblicken und ist damit die zweitälteste jüdische Gemeinde in Bayern, nach Regensburg. Konkret wird es mit dem Zweiten Kreuzzug 1147. In dieser Zeit ist auch in Würzburg der jüdische Friedhof unter dem heutigen Juliusspital entstanden.
Und wer hat in der Zeit zur Gemeinde gehört?
Familienoberhäupter waren Kaufleute und Gelehrte. Die jüdische Gesellschaft war in dieser Zeit in Clans, also in Großfamilien, organisiert. Das waren große Haushalte mit Verwandten und Mitarbeitern. Gerade die bedeutenden Familien haben sich über verschiedene Orte verzweigt. Im Museum „Shalom Europa“ gibt es beispielsweise den Grabstein der Hanna, die aus einer verzweigten Gelehrtenfamilie stammt.
Wie hat sich die jüdische Präsenz in Unterfranken entwickelt?
Im 13. Jahrhundert hat sich das jüdische Siedlungsnetz insgesamt stark verdichtet. In Unterfranken reichte es damals von Aschaffenburg bis Ebern und von Bischofsheim bis Röttingen. Würzburg war zu dieser Zeit – anders als später – das Zentrum, der „Vorort“.
Ganz wichtig waren die Gemeindeinstitutionen, die man damals gehabt hat, besonders der Friedhof. Auf dem Würzburger Friedhof wurden damals Jüdinnen und Juden aus der weiteren Umgebung begraben. In Schweinfurt gab es auch einen Friedhof. Dieser Friedhof wurde bei der Vertreibung der Juden aus Schweinfurt im 16. Jahrhundert zerstört. Vor 1349, dem großen Pestpogrom, bei dem die jüdische Gemeinde in Würzburg vernichtet wurde, gab es im heutigen Unterfranken nur diese zwei Friedhöfe.
Gab es zu dieser Zeit schon jüdisches Leben auf dem Land?
Jüdische Siedlungen auf dem Land hat es in Unterfranken schon vor den großen Pogromen, antijüdischen Ausschreitungen – den Pogromen von 1298 und 1349 – gegeben. Die Abwanderung der Juden auf das Land verstärkt sich im 15. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert geht die sprunghafte Judenpolitik der Würzburger Fürstbischöfe weiter, die vor allem aus wirtschaftlichen Gründen zeitweilig die Ansiedlung von Juden in ihrem Territorium duldeten. Gleichzeitig kommen die Ritterschaften als Schutzherren der Juden stärker ins Spiel. Für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts kann man dann sehen, wie sich das jüdische Leben auf dem Land stärker entwickelt.
Können Sie uns Beispiele nennen?
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstehen mehrere jüdische Friedhöfe auf dem Land: Bei Schwanfeld zwischen Würzburg und Schweinfurt, bei Kleinbardorf südöstlich von Bad Neustadt in der Rhön und am Untermain bei Reistenhausen auf der heutigen Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Diese gleichmäßig über Unterfranken verteilten Gebietsfriedhöfe, wo eine ganze Reihe von Gemeinden beerdigt hat, sind der Beleg dafür, dass dort jüdisches Leben existiert hat.
Und wie lange existiert das Landjudentum in Unterfranken weiter?
Letztlich bis 1933. Zu diesem Zeitpunkt existierten 109 Gemeinden in etwa 140 Siedlungen. Besonders wichtig waren die großen Gemeinden in Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt, Bad Kissingen und Kitzingen. Dort standen seit dem 19. Jahrhundert auch die großen Synagogen, die – bis auf die Synagoge in Kitzingen – heute nicht mehr existieren. Leider steht auch die prächtige Synagoge in Heidingsfeld nicht mehr, die Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde. Hier haben die Nationalsozialisten „ganze Arbeit geleistet“.
Und wann hat jüdisches Leben in den Städten Unterfrankens wieder begonnen?
Jüdisches Leben in den Städten beginnt zaghaft am Anfang des 19. Jahrhunderts. Zugelassen wurden beispielsweise vermögende Juden, wie die Familie Hirsch in Würzburg, von denen der Staat sich finanzielle Vorteile versprochen hat. Wirklich verbessert hat sich die Situation allerdings erst ab 1861. Vorher galt in Bayern die „Matrikelgesetzgebung“: Es gab für jeden Ort Listen, in denen verzeichnet war, wie viele jüdische Haushalte dort existieren durften. Ziel des Gesetzes war es ausdrücklich, die Zahl der Juden zu vermindern. Deswegen sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch viele Jüdinnen und Juden aus Unterfranken in die USA ausgewandert. Beispielsweise sind die Brüder Lehmann aus Rimpar nach New York emigriert, die Gründer der bekannten Bank „Lehman Brothers“.
Kann man in dieser Zeit eher von einem Neben- oder doch Miteinander von jüdischen und christlichen Unterfranken sprechen?
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es gelegentlich zu gewaltsamen antisemitischen Ausschreitungen, wie dem „Hep-Hep“-Pogrom 1819 in Würzburg. Später gab es sicherlich einige Orte, wo Juden und Christen gemeinsam tätig waren, beispielsweise in der Feuerwehr oder in Vereinen wie dem Fußballverein und dem Schützenverein. Es waren nicht selten Lehrer, die dabei eine führende Rolle gespielt haben. Das Privatleben hat sich dann allerdings weitestgehend im jeweiligen jüdischen, katholischen und evangelischen Milieu abgespielt.
Wie haben sich die christlichen Unterfranken in der Zeit des Nationalsozialismus verhalten?
Insgesamt war das Zusammenleben nicht so gefestigt, dass die Bevölkerung aufgestanden wäre, um ihre jüdischen Nachbarn zu schützen. Es gab punktuell Unterstützung für die Jüdinnen und Juden. Widerstandskämpferinnen – wie etwa die Würzburgerin Ilse Totzke, die versucht hat, einer Jüdin zur Flucht in die Schweiz zu verhelfen – waren aber sehr selten. Generell war im katholischen Milieu die Distanz zum Nationalsozialismus ausgeprägter als im evangelischen Milieu. Die Kirchen haben sich primär um ihre eigene Klientel, wie etwa die getauften Juden, gekümmert. Für die Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft haben sie sich nicht wirklich stark gemacht.
Und wie hat sich das jüdische Leben in Unterfranken nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt?
Danach sind wenige Überlebende zurückgekommen, die sofort das Gemeindeleben wieder aufgenommen haben. Eine wichtige Persönlichkeit war später der aus Brückenau stammende David Schuster. Er hat sofort erkannt, dass die Aufnahme der Kontingentflüchtlinge (aus der ehemaligen Sowjetunion, Anm. Red.) Anfang der 1990er Jahre neue Perspektiven für die jüdische Gemeinde in Würzburg und Unterfranken eröffnen würde.
Interview: Stefan W. Römmelt