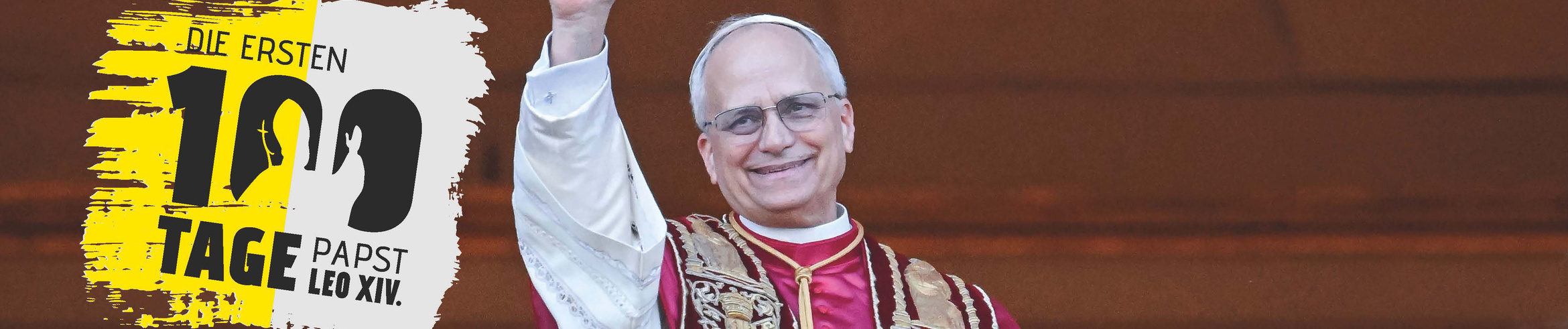Für mehr Inklusion zu sorgen, war das ausgewiesene Ziel des blinden Würzburgers, als er in den 1980er Jahren daran ging, junge Leute aus der Schule des Blindeninstituts für die Idee „Schulband“ zu begeistern. „Solche Bands gab es ja oft in Gymnasien“, sagt er. Warum nicht auch in einer Blindenschule? Auch wenn das Wort „Inklusion“ damals noch weithin unbekannt war, setzte sich Rummel für das ein, was der Begriff meint: Alle sollen gleiche Chancen erhalten egal, ob sie beeinträchtigt sind oder das Glück haben, unbeeinträchtigt leben zu dürfen.
Von Braille-Schrift inspiriert
Jahrelang hatte sich Rummel für die Fortentwicklung der „Braillers“ als einzigartige Inklusionsband eingesetzt. Dann kam Corona. Die „Braillers“, deren Name von der Braille-Schrift herrührt, durften nicht mehr proben: „Das war wirklich sehr bitter.“
Auch sein letztes Arbeitsjahr als Musiktherapeut im Blindeninstitut war durch das Virus überschattet. Phasenweise konnte er gar nicht mehr mit den Kindern arbeiten. Dann wurde die Therapie vorsichtig geöffnet. Doch ohne direkten Körperkontakt. Das sei für den Musiker extrem schwierig gewesen, denn er braucht seine Hände bei der Arbeit. Nur so kann er zum Beispiel fühlen, wie stark ein Kind angespannt ist.
„Musik ist so wichtig“
Für Menschen mit Handicap war es besonders schwer, durch Corona-Lockdown & Co zu kommen, sagt Rummel: „Ich habe mich oft doppelt bestraft gefühlt.“ Als er neun Jahre alt war, begann sein Augenlicht abzunehmen. Mit Mitte 20 war er bereits sehr stark sehbeeinträchtigt. Und mit 42 blind. Er lernte, mit seinen anderen Sinnen zu leben. Vor allem mit dem Tastsinn. Doch Berührungen sind nun schon lange tabu.
Während anderen die Pandemie „nur“ auf den Geist geht, weil so viel verboten ist, wurden Menschen mit Handicap richtig ausgeknockt. Einige Anordnungen sieht der Musiker kritisch, gerade aus musiktherapeutischer Sicht. „Musik“, sagt er, „ist für die Menschen so wichtig.“ Er hätte sich Regeln gewünscht, die das Singen im Gottesdienst möglich gemacht hätten. Spielt er in der Kirche Orgel, möchte er, dass die Leute dazu auch singen. Zum Glück ist das nun wieder erlaubt.
Problem mit Hartnäckigkeit gelöst
Inklusion gehört zu jenen Prozessen die viel Zeit brauchen und wohl nie ganz zu Ende sind, findet er. Immerhin ist heute vieles besser als vor 40 Jahren, als Rummel begann, Kirchenmusik zu studieren. Das sei sogar damals unproblematisch gewesen. Als er sich danach zum Musiktherapeuten weiterbilden wollte, fingen die Probleme allerdings an: Man wollte ihn wegen seiner Sehbehinderung nicht nehmen. „Ich habe gesagt, sie sollten es mich doch probieren lassen, und wenn es nicht geht, könnten sie mich ja immer noch rausschmeißen!“ Das machte Eindruck. Rummel durfte beginnen. Und keiner hat ihn rausgeschmissen.
Heute ist vieles besser, doch die letzte Hürde in puncto Inklusion sei noch längst nicht genommen, meint er. „Hören die Leute ‚Inklusion’, denken sie an Schule ...“ Inklusion meint aber mehr. Es bedeute letztlich „alles“: Unsere Gesellschaft sollte so gestaltet sein, dass jeder klarkommt. Dieses Ideal scheitere oft an Banalitäten, bedauert der Katholik. Etwa daran, dass Autos so parken, dass ein behinderter Mensch nicht zwischen ihnen durchkommt. Oder schlicht durch eklatantes Unwissen: „Neulich wurde ich auf einem Campingplatz gefragt, wo die Schnur an meinem Stock sei.“ Der Frager dachte, der Blindenstock sei eine Angelrute.
Musiktherapeut im Blindeninstitut
Der Beruf des Musiktherapeuten ist Rummel auf den Leib geschneidert. Den Einstieg in die Arbeit im „Blindi“, wie das Blindeninstitut allgemein genannt wird, hat der Musiker dem Architekten der Einrichtung zu verdanken. Zufällig lernte er ihn kennen und erfuhr von dem Institut in Lengfeld. Davon hatte er noch nie gehört. Er klopfte dort an und erhielt als Student der Musiktherapie sofort die Chance, ein Praktikum abzuleisten.
Der damalige Chef war von ihm so angetan, dass er Rummel 1985 anstellte: „Ich habe daraufhin begonnen, den musiktherapeutischen Bereich ganz neu aufzubauen.“ Auch im Ruhestand will er sich intensiv mit Musik beschäftigen. Ein Leben ohne Musik ist für ihn schlicht nicht vorstellbar.
Beratung für andere Blinde
Das Rentnerdasein beschert ihm auch wieder die Zeit, sich in St. Lioba als Organist zu engagieren. Das hat der einstige Orgelassistent im Würzburger Dom früher schon mal getan. Doch irgendwann hatte er dazu die Zeit nicht mehr.
Noch bis Ende nächsten Jahres wird Rummel außerdem als „Peer-Berater“ in der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) des Blindeninstituts aktiv sein. Da berät er Leute, die Fragen zu Sehbehinderung haben. Das Wort „peer“ könnte man etwa mit „Gleichfalls Betroffener“ übersetzen. Fragen wären etwa: Ist es möglich, den Traumjob trotz starker Sehbehinderung zu bekommen? Wie geht man damit um, wenn ein Familienmitglied erblindet? „Ich höre den Menschen zu, die zu uns kommen, erzähle von meinen Erfahrungen und motiviere“, sagt er. Rummel hofft, dass es mit der Beratung über das Jahr 2022 hinaus weitergeht, dazu braucht die Einrichtung der Blindeninstitutsstiftung aber eine Anschlussförderung.
Eine neue Band?
Wer heute jenseits der sechzig ist, gehört noch sehr lange nicht zum alten Eisen. Und so hat auch Markus Rummel erste Pläne für einen regen Ruhestand. Klasse wäre es für den Pianisten, E-Bassisten und Alphornbläser, würde er in einer neuen Band spielen können. Denn mit anderen zusammen Musik zu machen, das liebt er. Ebenso, wie er Auftritte liebt. Unvergessen bleibt der erste große Auftritt der „Braillers“ bei der Sternstunden-Gala, wo die Band mit einem Rock-'n'-Roll-Medley begeisterte.
Wunderbar am Ruhestand ist, dass man wählen kann, ob man dies oder lieber jenes tut. Rummel, der es liebt, in Freiheit tätig zu sein, was ihm als Musiktherapeut auch vergönnt war, freut sich auf die kommenden Jahre. Und ist gespannt, was sie ihm bescheren werden. Im Juli hat er seine Nachfolgerin eingearbeitet, jetzt ist er endgültig frei.
Was die „Braillers“ anbelangt, wünscht er sich, dass sie die Kurve kriegen und weitermachen, trotz des langen Probenstopps. Er selbst habe eine Idee, die er gerne verwirklichen würde, wenngleich er noch nicht weiß, wie: Er würde gerne Sehenden vermitteln, was er durch seine anderen Sinne wahrnimmt: Über das Gehör. Den Tastsinn. Und ganz besonders durch das Riechen.
Pat Christ