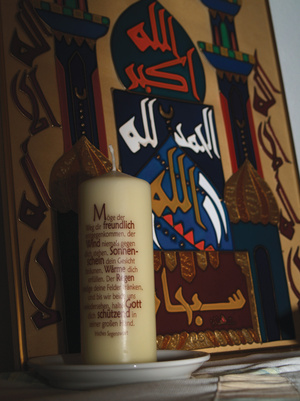Rund drei Millionen Muslime leben in Deutschland
Ehen zwischen Christen und Muslimen haben seit dem Ende der 1960er Jahre mit der Gastarbeiterzuwanderung zugenommen, so hat es Salim Abdullah, Leiter des „Zentralinstituts Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e. V.“ in Soest, beobachtet. 1962 lebten rund 16 000 Muslime in Deutschland, im Jahr 2007 lag ihre Zahl bei 3 224 000. Es sei in den islamischen Ländern durchaus Tradition, dass Muslime mit Jüdinnen oder Christinnen verheiratet waren. Diese Tradition habe man in der Diaspora fortgeführt, erläutert Salim Abdullah. Genaue Zahlen zu Ehen zwischen Muslimen und Christen gibt es allerdings weder vom Statistischen Bundesamt noch vom Zentralinstitut. Fest steht aber laut Bundesamt, dass 1991 rund 9,7 Prozent der in Deutschland geschlossenen Ehen zwischen Deutschen und Ausländern eingegangen wurden, 0,97 Prozent davon zwischen Deutschen und Türken. 2007, gut 15 Jahre später, stieg die Zahl der Eheschließungen zwischen Ausländern und Deutschen auf 11,8 Prozent an und die deutsch-türkischen Ehen auf 1,55 Prozent. Kassem und Josefine A. sind Teil dieser Statistiken. Der Iraker Kassem ging Anfang der 1960er Jahre nach Deutschland, um in Marburg Medizin zu studieren. 1967 lernte er dort während einer Weihnachtsfeier der Katholischen Hochschulgemeinde seine heutige Frau Josefine kennen, die als Krankenschwester arbeitete. Für beide war die Religion des Anderen kein Beziehungshindernis, deswegen entschlossen sie sich, vier Jahre später zu heiraten. An die Bedenken der Eltern erinnert sich das Ehepaar auch nach 37 Jahren noch gut. Kassems Eltern glaubten, die unterschiedlichen Religionen würden bald ein Streitthema des Paares werden. „Ich habe meinen Eltern aber klar gemacht, dass mir dieses Mädchen sehr gefällt, und da wünschten sie mir viel Glück“, erinnert sich Kassem. Salim Abdullah vom „Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschand Stiftung e. V.“ kennt solche Vorbehalte von Eltern. Schon seit rund 30 Jahren berät er heiratswillige Christen und Muslime. Viele muslimische Eltern wünschten sich aber einen muslimischen Partner für den Sohn oder die Tochter, weil dieser die eigene Religion und Kultur besser verstünde. Deshalb forderten sie den Übertritt des christlichen Partners zum Islam, berichtet Salim Abdullah. Er rät jedoch in den meisten Fällen von einem Übertritt ab. „Man sollte niemandem eine andere Religion überstülpen“, sagt er. Lieber sollten die Paare einen Weg finden, die Eltern zu überzeugen. Josefine hatte nie ernsthaft überlegt, zum Islam überzutreten. „Ich konnte es nicht, weil mir der christliche Glaube viel zu wichtig war“, sagt sie und schüttelt den Kopf. Kassem akzeptiert die Meinung seiner Frau. „Sie glaubt an Gott, und das ist ein Vorteil“, sagt er. Für ihn trage sie den Islam genauso wie ihren eigenen Glauben im Herzen. Er selbst hatte ebenfalls nie einen Übertritt ins Christentum erwogen. Laut dem Koran sei der Islam die letzte Botschaft Allahs an die Menscheit, die auch alle früheren Botschaften enthalten, begründet Kassem seine Überzeugung für den Islam. Geheiratet wurde im Marburger Standesamt. Die Eheleute hatten sich darauf geeinigt, weder nach islamischem noch nach katholischem Ritus zu heiraten. „Josefines Mutter fragte nach einer kirchlichen Hochzeit, und ich antwortete ihr, dass ich nicht vor einem katholischen Priester stehen und seine Worte nachsprechen möchte, denn sie sind nicht bindend für mich“, begründet Kassem. Seine Frau akzeptierte die Entscheidung, obwohl sie sich eine kirchliche Trauung gewünscht hätte. Dies sei ein Kompromiss gewesen, sagt sie.
Die Christin war bei ihrer neuen Familie willkommen
Kassem und Josefine verließen kurz nach der Eheschließung Marburg und gingen in den Irak, denn Kassem wollte in seinem Heimatland als Arzt arbeiten. Schnell fand er dort eine Anstellung und seine Frau kümmerte sich um den Haushalt. Wie in vielen orientalischen Staaten üblich, wurden sie von den Eltern des Ehemannes aufgenommen und lebten mit ihnen unter einem Dach. Die christliche Schwiegertochter war in ihrer neuen Familie willkommen. Christen waren Anfang der 1970er Jahre keine Seltenheit im Irak, denn neun Prozent der irakischen Bevölkerung bekannten sich zum christlichen Glauben. Sie seien seit Tausenden von Jahren Teil der dortigen Bevölkerung, betont Kassem. Sie konnten in dem überwiegend von Muslimen bewohnten Staat ihren Glauben offen praktizieren. Viele Freunde und Nachbarn des Ehepaares waren ebenfalls Christen.
Familie feiert gemeinsam Weihnachten und Ramadan
Es gab keine Berührungsängste unter den Gläubigen beider Religionen, und man lud sich oft gegenseitig ein. Diese Begegnungen machten Josefine neugierig auf den Islam. „Ich bin dort auch einmal in einer Mosche gewesen“, erinnert sie sich. Sie nahm aber auch an den muslimischen Festen wie zum Beispiel dem Ramadan, dem muslimischen Fastenmonat, im Haus teil und fastete mit. Aus gesundheitlichen Gründen hielt sie das islamische Fasten, bei dem tagsüber weder gegessen noch getrunken wird, jedoch nicht durch. Stattdessen besann sie sich auf das christliche Fasten zur Osterzeit und verzichtete während des Ramadans auf Süßigkeiten und Fleisch, wie sie es schon als Kind getan hatte. „Das haben damals nicht viele bemerkt. Aber das war nicht schlimm, denn ich habe es für Gott und für mich getan“, sagt Josefine. Auch Ostern und Weihnachten feierte die muslimisch-christliche Familie. Josefines deutsche Familie sandte ihr per Post einen künstlichen Weihnachtsbaum. Diesen schmückte sie mit Strohsternen und einer Lichterkette und stellte ihn im Wohnzimmer neben einer Papierkrippe auf. Am Heiligen Abend kochte sie für ihre Familie ein Festtagsessen, manchmal waren auch ihre muslimischen Nichten zu Gast. „Es gab zum Beispiel Rindfleisch oder Lamm. Das war etwas Besonderes, weil Fleisch schwer zu bekommen war“, berichtet sie.
Außerdem sah sie sich zusammen mit Mann und Kindern einen Weihnachtsgottesdienst im Fernsehen an. Er wurde jedes Jahr von vielen christlichen Konfessionen, wie zum Beispiel den Katholiken, Orthodoxen und den Chaldäischen Christen, zusammen in einer christlichen Kirche gefeiert. Wichtiger Bestandteil des Festes war für Josefine auch das Weihnachtsevangelium. „Das habe ich für mich gelesen, das gehört einfach dazu“, sagt sie, aber auch die Geschenke. Sie kamen von den deutschen und den irakischen Verwandten und wurden gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt. Zu Ostern besuchte Josefine mit ihren Kindern einige Male den Ostergottesdienst. Sie lud außerdem die irakischen Verwandten zum Festtagsschmaus ein und bekam wiederum Geschenke von ihnen.